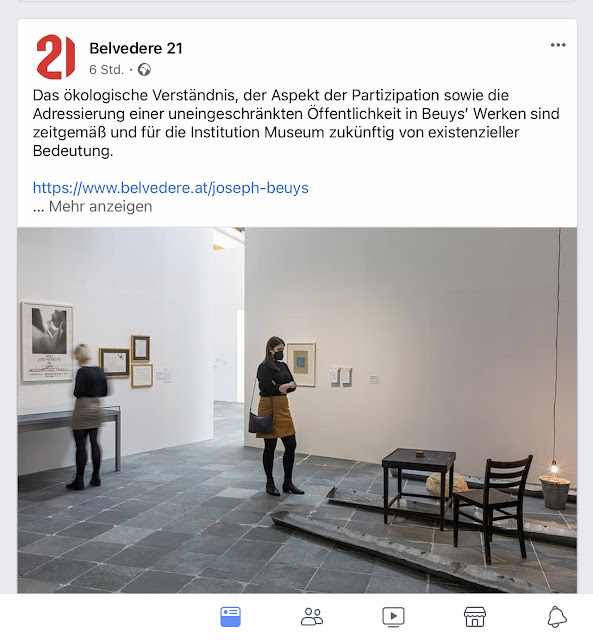Das Museum als aktiver Moderator sozialer Demokratie
0
Dieser Text basiert auf Notizen, die einem Beitrag zu einer Veranstaltung zu Erinnerungskulturen der sozialen Demokratie zugrunde lagen. Die von der Hans Böckler Stiftung veranstaltete Zusammenkunft hatte den Untertitel Soziale Demokratie im Kulturhistorischen Museum. Wege zum partizipativen Museum. Meine für fünfzehn Minuten Redezeit vorbereiteten Überlegungen waren eher fragmentarisch und sind es mit ein paar Glättungen und Ergänzungen auch geblieben.
1
Was wäre das - ein Museum der sozialen Demokratie?
Welche Erwartungen knüpfen sich an ein solches Museum?
Kann es so etwas geben, ein Museum, in dem die sozialen Bürgerrechte repräsentiert werden?
Soziale Demokratie, so lege ich es mir zurecht, ist eine gesellschaftliche Ordnung, in der nicht nur die verschiedene Menschen-, Grund- und Freiheitsrechte gesichert sind, sondern auch die materiellen Bedingungen und soziale Rechte, die den Genuss dieser Grund- und Freiheitsrechte überhaupt erst ermöglichen.
Für mich ergeben sich daraus drei Fragen: Wie weit wird das Museum als Organisation diesem Anspruch gerecht? Wie spiegeln die Sammlungspolitik, die Sammlung und die und die Ausstellungen diesen Anspruch? Und schließlich: Welches Verhältnis pflegt das Museum zu seinem Publikum und generell zur Öffentlichkeit. Wie bestimmt es seinen Platz und seine Aufgabe innerhalb Gesellschaft.
2
Ich möchte zuerst kurz skizzieren, wie ich die drei Anforderungen in der derzeitigen Museumspraxis realisiert bzw. nicht realisiert sehe.
Zur ersten Frage: Ist das Museum eine Organisation, die man demokratisch nennen kann, in der soziale Demokratie selbst verankert ist? In welchen Museumsorganisationen ist Demokratie eine zentrale Handlungsorientierung und etwas, was die innerbetrieblichen Machtverhältnisse, Abläufe und Entscheidungen prägt?
Ich kann dazu nur beispielhaft und anekdotisch etwas beitragen, ich kenne keine empirischen Untersuchungen zu musealen Organisationsformen.
Was mir sofort eingefallen ist, ist der einzige mir bekannte Versuch, gewerkschaftliche Mitbestimmung in Museen einzuführen. Das sogenannte Hamburger Modell vom Anfang der 70er-Jahre, das von MItarbeiterInnen der kommunalen Hamburger Museen gefordert und von den Museumsleitern heftig bekämpft wurde. Der von mir geschätzte Leiter der Hamburger Kunsthalle entsetzte sich mit der Vorstellung Da könne ja nun jede Putzfrau bei den Ausstellungen mitbestimmen.
Keine gewerkschaftliche aber überhaupt Mitsprache forderten jüngst die Leiter der Museen der Stiftung Preussischer Kulturbesitz ein, um sich in einen Evaluationsprozess einzuklinken, der zunächst ohne ihr Wissen und zutun von der Kulturstaatssekretärin begonnen worden war und im dem eine Zeit lang die Zerschlagung der Stiftung im Raum stand. Die mir völlig sinnvoll und selbstverständliche Beteiligung der Museumsdirektoren wurde von einer großen überregionalen Zeitung gar als basisdemokratische Revolution bezeichnet.
Ein anderes Beispiel für Implementierung sozialer Demokratie ist der Versuch, an den österreichischen Bundesmuseen einen Kollektivvertrag durchzusetzen. In erster Linie wird das zur Verbesserung der Anstellungsbedingungen und Entlohnung der Vermittlerinnen führen - die weibliche Form ist hier angebracht, es ist überwiegend ein Frauenberuf, nicht gut bezahlt und mit prekären Bedingungen. Für die Realisierung dieses Vorhabens, so höre ich, gibt es gute Aussichten.
3
Ich komme zur zweiten Frage: Wie spiegeln die Sammlungspolitik, die Sammlung und die Ausstellungen den Anspruch soziale Demokratie im Museum zu repräsentieren? Das heißt, wie wird die Geschichte der Arbeit, der der Arbeiterbewegung und ihrer Organisation, der sozialen Kämpfe und Reformen, der Organisation der Arbeiterschaft und vieles andere mehr durch Museen repräsentiert.
Da kann ich mich auf eine umfangreiche Recherche von Wolfgang Jäger berufen, der sich in einer Reihe deutscher kulturhistorischer Museen auf die Suche nach sozialer Demokratie in Ausstellungen gemacht hat. (Wolfgang Jäger: Soziale Bürgerrechte im Museum. Die Repräsentation sozialer Demokratie in neun kulturhistorischen Museen. Bielefeld 2000. Mir stand ein umfangreiches Manuskript von Wolfgang Jäger zu diesem Thema zur Verfügung). Sein Befund ist ernüchternd, aber nicht überraschend. In vielen (kultur)historischen Museen ist er kaum bis gar nicht fündig geworden. Soziale Demokratie spielt in den Erzählungen der einschlägigen Museen, nicht jene Rolle, die ihr in der Wirklichkeit zugekommen ist und zukommt. (*)
Ich denke, in Österreich würde eine ähnliche Recherche ebenso ernüchternd ausfallen und die Existenz des Museums Industrielle Arbeitswelt Steyr, auf Initiative der Gewerkschaftsjugend gegründet, das verdienstvolle Ausstellungen macht, muß man ebenso als eine Ausnahme aus der Regel ansehen wie das wunderbare Museum Das Rote Wien im Waschsalon des Karl Marx-Hofes in Wien, das die Kommunalpolitik des sozialistisch regierten Wien in der Ersten Republik zeigt aber auch den hohen Grad und die Qualität der Selbstorganisation der Arbeiterschaft.
4
Die dritte Frage ist die nach der Beziehung des Museums zu seinem Publikum und zur Gesellschaft insgesamt.
Wie sattsam bekannt, gibt es eine inzwischen universale Kennzahl, die über den Wert und Wirkung von Museen - vermeintlich - Auskunft gibt. Die Anzahl der Besuche(r).
Jüngst las ich, daß eine englische Tageszeitung eine Bezahlung der MitarbeiterInnen nach der Zahl der Klicks ihrer Artikel einführen will. Noch ist es am Museum nicht so weit, aber die Bindung von „Erfolg“ und „Wert“ der Institution ist schon lange eng mit der Besucherstatistik gekoppelt. Damit einher hat sich eine Art neoliberaler Wettlauf entwickelt – in Österreich zwischen den großen Kunstmuseen -, um mediale Aufmerksamkeit innerhalb der Konkurrenz der vielfältigen (hoch)kulturellen Angebote.
Was aber noch nachhaltiger zu wirken begonnen hat ist die Gleichsetzung dieser Zahlen mit der Vorstellung allgemeiner Zugänglichkeit und Akzeptanz des Museums. Die bei einzelnen Museen in die Hunderttausende gehenden statistischen Zahlen (der Louvre als einsamer Spitzenreiter übertraf die 10-Millionen-Marke) legen nahe, daß Museen universal zugängliche Bildungsinstitutionen sind – und daher demokratisch.
Diese irreführende Gleichsetzung ist alt. 1919 formulierte der Direktor der Hamburger Kunsthalle, Gustav Pauli, den Satz, daß das Museum zu den "demokratischesten aller Bildungsinstitute“ gehört, das "jedermann ohne Legitimationsprüfung den Vorteil seiner stummen Belehrung gewährt.“
Das verrät nicht nur eine paternalistische pädagogische Haltung, Pauli legt uns nahe, das Museum als im sozialen Sinn völlig barrierefrei wahrzunehmen.
Spätestens seit den 80er-Jahren weiß man, dass das ganz und gar nicht stimmt. Etwa 50% einer Bevölkerung sind keine Museumsbesucher. Sie haben nicht die materiellen Voraussetzungen und verfügen nicht über die nötige Vorbildung.
Das Museum ist ein Ort der sozialen Distinktion
Und weil das Museum dennoch allgemeine Geltung seiner Werte vertritt, ist es auch ein Ort der kulturellen Hegemonie.
5
Ich möchte nun meine drei Fragen noch einmal durchgehen, und überlegen, wie denn das Museum zu einem Ort der sozialen Demokratie, ein aktiver Moderator von Demokratie überhaupt werden kann.
Es liegt auf der Hand, dass sich die Organisation selbst verändern müsste, sowohl nach innen. als auch was ihre Einbettung in politisch-administrative Prozesse betrifft. Es muss in der Organisation veränderte Entscheidungsprozesse und Arbeitsabläufe geben; keinem Museum sollte erlaubt werden, von Partizipation sprechen dürfen, wenn es nicht Partizipation im weitesten Sinn in der Organisation selbst zulässt.
Und ohne kultur- und museumspolitischen Rahmen kann es kaum so etwas wie eine Vermittlung zwischen gesellschaftlichen Interessen und Bedürfnissen und institutionellem Handeln geben.
Man wird drittens nach Wegen suchen müssen, das Museum zur Gesellschaft hin durchlässiger zu machen, über Partizipation hinaus Teilhabe zu ermöglichen, in der in die Regeln der Institution eingegriffen werden darf. Denn Partizipation heißt, wenn sie mehr sein soll als ein von der Institution veranstaltetes und kontrolliertes Mitmachen, zuzulassen, dass sie die Institution selbst verändert.
Betriebe man das konsequent, dann hieße das, daß Museen Macht abgeben und Kontrolle mindestens lockern müssen. Dazu würden Museen bereit sein?
6
Nun zur Frage nach der Öffentlichkeit des Museums. Diese Frage ist eine nach den Grundlagen unseres Verständnisses von Museen. Um mich verständlich zu machen, schiebe ich einen kurzen Exkurs zur Entstehung jenes Modells Museum ein, das wir immer noch gebrauchen. Es wird sich zeigen, wie verarmt das heute gebräuchliche Reden von der Öffentlichkeit des Museums geworden. Und ich möchte eine Grundlage gewinnen dafür, wie eine öffentliches Museum neu gedacht werden könnte.
Die Entstehung des Museums der Moderne hat ein präzises Datum. Am 10. August 1793 findet in Paris ein Fest, ein Umzug statt, ein Gründungsakt der Nation. Es wird am selben Tag eine neue Verfassung deklariert, die erste republikanische Frankreichs. Und am selben Tag wird das Museum im Louvre eröffnet.
Das Museum steht im Zentrum der Formierung einer Nation. Das Museum ist ein Ort eines zivilisierenden Rituals. Seine Rolle ist die, der Gemeinschaft zu ermöglichen, sich um das kulturelle Erbe zu scharen. Um Dinge, die ihre Funktion, ihren Sitz im Leben verloren haben, die aus der Warenzirkulation als unveräußerlich herausgehalten werden und darum so etwas wie einen heiligen Schatz bilden.
Dieses Erbe, die musealen Sammlungen repräsentieren die res publica, das Ding, das etymologisch als Thing in ein- und demselben Wort sowohl auf Sache und Sammlung als auch auf Versammlung (das Sich-Versammeln im Museumsraum) verweist. Es ist jene, im Grunde unidentifizierbare gemeinsame Sache, um derentwillen sich Gemeinschaften bilden, und die im Museum repräsentierbar scheint.
Das Museum (der Französischen Revolution) wirkt dabei auch kompensierend. Es kompensiert den Verlust von die Gemeinschaft zentrierenden, zusammenhaltenden transzendentalen Prinzipien und deren irdische Repräsentation, in Frankreich den des Königs und seiner zwei Körper, des göttlichen und des irdischen. Der wird angeklagt und wenige Monate nach der Museumseröffnung hingerichtet. Das Wegbrechen einer transzendentalen Identifikation hat die Suche nach neuen, nun innerweltlichen Formen der Identifikation zur Folge. Eine Antwort ist das Museum.
7
Das Museum ist ab nun ein zivilisierendes Ritual. Aber es ist ab nun auch ein Ort der Vermittlung von Sach- und Orientierungswissen, von Geschichtserfahrung an – im Idealfall – für alle Staatsbürger.
Als Ort der Zivilisierung ist es einer, an der sich Bürger zu Staatsbürgern bilden, indem sie sich um ihre gemeinsamen und insofern öffentlichen Angelegenheiten kümmern. Die Öffentlichkeit der Institution Museum enthält also ein Versprechen von Gleichheit und Freiheit wie von Verantwortung aller Bürger für das Gemeinwohl.
Das Museum ist also beides zugleich: der Ort an dem Zivilisierung dargestellt und an der sie hergestellt wird.
Damit das geleistet werden kann, bedarf es einer bestimmten Struktur des Museums, eine, die in aus vier Merkmalen besteht.
Garantiertes Recht auf Bildung und der materiellen Voraussetzungen dazu
Allgemeine Zugänglichkeit
Gemeinschaftlicher Besitz der Kulturgüter
Und gemeinschaftliche Finanzierung, das heißt, aus Steuermitteln
Das ist die Grundlage des Verständnisses vom Museum als einer Instanz, die das gesellschaftliche Ziel, den Auftrag des Wohlfahrtstaates, das maximale Glück einer maximalen Zahl zu erreichen, verwirklicht.
Für unsere Frage nach dem Museum der sozialen Demokratie ist die rechtliche Regelung interessant, auf die am Beginn der Museumsentwicklung, diese Struktur ruht. In der Verfassung von 1793 heißt es im Artikel 22: „Der Unterricht ist für alle ein Bedürfnis. Die Gesellschaft soll mit aller Macht die Fortschritte der öffentlichen Aufklärung fördern und den Unterricht allen Bürgern zugänglich machen.“
Im unmittelbar vorangehenden Artikel 21 findet sich das: „Die öffentliche Unterstützung ist eine heilige Schuld. Die Gesellschaft schuldet ihren unglücklichen Mitbürgern den Unterhalt, indem sie ihnen entweder Arbeit verschafft oder denen, die außerstande sind, zu arbeiten, die Mittel für ihr Dasein sichert.“
8
Dieses Museumsmodell ist ein Ort liberaler, bürgerlicher Öffentlichkeit. Diese Öffentlichkeit hatte das Aushandeln von Konflikten unter Gleichen und damit die Harmonisierung von Konflikten zum Ziel. Tendenz zur Harmonisierung ist aber auch eine Eigenschaft des Museums. Seine Erzählweisen und Darstellungsmethoden neigten lange Zeit dazu, uns Unschuldskomödien vorzuspielen, alles in eine Geschichte der fortschreitenden Zivilisierung zu verwandeln unter Aussparung der traumatisierenden und gewaltförmigen Aspekte.
Dieses Modell scheint erschöpft. Und das Museum hat sich auch gewandelt, die Triumpherzählungen werden seltener, die Einbeziehung von Schuld und Trauma selbstverständlicher. Und inzwischen fordern immer mehr Gruppen ihren Einschluß in die musealen Erzählungen und das macht Museen diverser. Die aktuelle Debatte um den Umgang mit kolonialem Erbe zeigt indes, wie schwer die Umstellung fällt, welcher Widerstand sichtbar wird.
Museen müssen fähig gemacht werden, Konflikte anzusprechen und auszutragen, Interessen, Ideologien, Machtverhältnisse offenzulegen. Vermittlungs- und Diskursformen müssen geeignet sein, dem Rechnung zu tragen. Eine sehr schwierige Anforderung angesichts der wachsenden Polarisierungen und der Zerfallserscheinungen bürgerlicher Öffentlichkeit unter dem vieldiskutierten Druck der sogenannten sozialen Medien.
Zuallererst muss sich aber das Museum selbstreflexiv seiner Mechanismen des Erzählens und Bedeutens vergewissern – und seiner problematischen Sublimierungsleistung. Ein grundlegender Wandel müsste sich auch auf organisatorischer Ebene vollziehen, die Arbeitsaufgaben und Rollenverständnisse würden sich drastisch ändern, KuratorInnen wären dann nicht im Wortsinn „Sorgenträger“ ums Objekt, sondern Moderatoren politischer Auseinandersetzungen.
Es ist ja nicht so, dass die Museen bislang nicht schon Grundfragen unserer Zivilisation repräsentiert hätten, die wachsender Naturbeherrschung und Naturzerstörung, die Naturbeherrschung am Menschen, die Eroberung und Vernichtung fremder und vergangener Kulturen, die Gewaltförmigkeit in der Geschlechterbeziehung und anderes mehr.
Aber das Museum kann angesichts der Klima- und Coronakrise, der Bedrohung der Demokratie, der wachsenden Ungleichheiten, der grassierenden Zukunftslosigkeit der Politik nicht an der bloßen Ästhetisierung und Sublimierung der Probleme und Konflikte festhalten. Es kann sich auch nicht als neutraler Beobachter verstehen, der selbst aus den Konflikten ausgenommen ist. Gerade die Coronakrise zeigt ja, daß das Museum nicht einfach nur sammlungspolitisch reagieren kann wie ein Sammler, der Indizien zusammenträgt. Denn es ist ja selbst vielfach betroffen, finanziell, hinsichtlich seiner Besucher und hinsichtlich seiner Legitimation angesichts der Zweifel an seiner „Systemrelevanz“.
Das Museum muß sich als politischer Akteur verstehen, der sich den genannten und von mir nur fragmentarisch aufgezählten Problemen annimmt. Sonst verfehlt es seine Aufgabe, nervöses Auffangsorgan (Aby Warburg) zu sein. Als solches muss das Museum Ort agonaler, also konfliktfähiger, streitbarer Öffentlichkeit sein.
Agonistische Öffentlichkeit (Chantal Mouffe) deklariert die Interessen, benennt die Probleme, macht sie kenntlich und lässt sie aufeinandertreffen. Agonale Öffentlichkeit ist vielfältig und vielgestaltig. Konflikte zu bearbeiten geht nur im Medium des Konflikts selbst, weil nur so Differenzen, Standpunkte und Interessen sichtbar gemacht und bearbeitet werden können. Das Museum wäre dann ein Ort der streitbaren und pluralen Gegenöffentlichkeiten, wo herkömmliche Werte und Normen infrage gestellt und auch angegriffen werden könnten. Das Museum müsste sich vom affirmativen hegemonialen zum Raum der Unruhe und des Dissens wandeln. Um dieser Vorstellung etwas die Schwere der sozialpolitischen Bürde zu nehmen, die man dem Museum auflastet, greife ich zwei Worte auf, die kürzlich die Schriftstellerin Marlene Streeruwitz gebaucht hat: Kritikübungsräume. Solidaritätsversicherungsversuche.
Der Zweck demokratischer Institutionen“ besteht, schreibt der australische Aktivist Simon Sheik „nicht in der Herstellung eines rationalen Konsenses in der Öffentlichkeit, sondern in der Entschärfung des Potenzials für Feindseligkeiten, das in menschlichen Gesellschaften existiert, indem die Transformation von Antagonismus in 'Agonismus' ermöglicht wird."
Erst wenn Museen sich selbstreflexiv zu verhalten lernen, wenn sie sich gegenüber der Öffentlichkeit öffnen, wenn sie sich reorganisieren kann das Museum zu dem Ort werden, als der er von Anfang an gedacht war: einer der Selbstauslegung, einer der Aufklärung der Gesellschaft über sich.
(*) Im Beitrag von Sabine Kritter, Imaginationskrise der Arbeit und die Kulturalisierung der Gegenwart im Museum, fand dieser Befund insofern eine Ergänzung und Vertiefung als dort von einer Kulturalisierung der Darstellung der Arbeit gesprochen wurde, die aber im gegenwärtigen Ausstellen kaum noch vorkomme. Es gibt eine Krise des Vorstellungsvermögens von Arbeit, viele Tätigkeiten würden entweder gar nicht als Arbeit angesehen oder es sei zweifelhaft, ob es sich um Arbeit handle.
März 2021