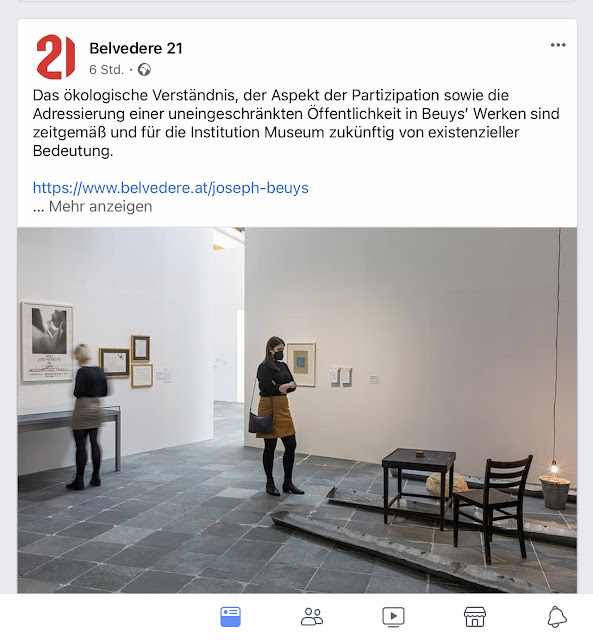Pomians herausfordernder Text sollte diskutiert werden. Wer immer Lust hat, sich zu dem Text und meiner Replik zu äußern - es steht eine Kommentarfunktion am Ende des Posts zu Verfügung. Wer seine Email-Adresse hinterläßt kann von mir Pomians Text zugesendet bekommen. Eine weitere Reaktion auf den Text findet sich hier: https://museologien.blogspot.com/2020/11/am-ende-das-museum.html
 |
| Marcel Broothaers buddelt einen Museumsgrundriß in den belgischen Meeresstrand. Vielleicht spült die Flut alles schon weg, ehe die Arbeit vollbracht ist... |
Man muß das Museum verabschieden können, um es völlig neu zu erfinden
Meine erste Reaktion auf Krzysztof Pomians in der FAZ veröffentlichten Text hat mir den Vorwurf des "Wiener Pessimismus" (Helmut Bien) eingetragen. Damit kann ich provisorisch gut leben, mit der Einschränkung, daß ich kein Wiener bin. Was meinen angeblichen Pessimismus betrifft, da denke ich, dass es ein Missverständnis gibt, die möglicherweise durch mangelnde Genauigkeit in meinem ersten Text verursacht wurde.
Ich habe gesagt, daß ich Pomians Pessimismus nicht viel entgegenhalten kann. Das heißt aber nicht, daß ich ihn teile. Ich stelle mir eine einfache Frage: Ist es eher erwartbar, daß ein umfassender globaler Lernprozess einsetzt, der den Klimawandel stoppt und katastrophische Folgen abwendet oder eher daß ein solcher rechtzeitiger Wandel nicht zustandekommt und die verschiedenen düsteren Prognosen sich in unbestimmbarer, aber vielleicht nicht so ferner Zukunft bewahrheiten?
Ich weiß es nicht. Den einen Tag lese ich, daß die unbedingt notwendige Begrenzung der Erwärmung um 2 Grad sicher nicht erreicht wird, den anderen Tage erreicht mich die Nachricht, daß die EU einschneidende klimapolitische Ziele vereinbart hat.
Anders als Pomian räume ich dem Museum die Möglichkeit ein, sich auf unterschiedliche Zukünfte einzustellen und sich nicht bloß mit der Prophezeiung ihres Untergangs abzufinden. Das muß, wenn man dem Ernst der Situation gerecht werden will, nicht weniger eine Art "Neuerfindung" des Museums voraussetzt - ein unglaublich einschneidender „Turn“ auf allen Ebenen.
Hier stelle ich eine ähnliche Frage, wie zum Klimawandel: Ist es wahrscheinlicher, daß die Museen nachhaltig und konsequent eine andere Politik, eine eine andere Geschichts- und Erinnerungskultur entwickeln, neue organisatorische, mediale, inhaltliche usw. Wege einzuschlagen oder ist es wahrscheinlicher, daß es weitgehend so bleibt wie bisher?
Ein Beispiel: Ein grosses österreichisches Naturmuseum vernetzt sich mit verschiedenen Organisationen und ruft dazu auf, an einem bestimmten Datum, Kerzen als Warnung vor dem Klimawandel in die Fenster zu stellen. Warum nicht kann man fragen? Es wirbt mit eindrucksvollen Texten auf Facebook. Das Museum reagiert und wird aktiv, es geht buchstäblich und symbolisch über seine Grenzen. Man kann aber auch einwenden, dass eine solche schon vielfach für unterschiedlichste Zwecke gebrachte „Lichter-Mahnwache“ bereits zu abgenutzt ist, um noch weitere Besetzungen mit neuen Bedeutungen auszuhalten. (Nahezu gleichzeitig wird dieselbe „Mahnpraxis“ für Opfer der Pandemie organisiert). Und welchen Impuls gibt so eine Aktion über das Symbolische hinaus ins praktische Handeln?
Dasselbe Museum lädt, wiederum via Facebook, dazu ein, sich mit der Mineraliensammlung zu beschäftigen, im Internet, um dort einschlägiges Wissen abzuholen. Wiederum kann man sagen, warum nicht? Das Museum nutzt, was derzeit von überall her empfohlen wird, das Internet, um in Zeiten der Schliessung der Museen, Bildung zu vermitteln. Von Naturmuseen weiss man außerdem, dass es eine bestimmte Klientel von Hobbysammlern und Kennern gibt, die als Gruppe wichtig für solche Museen sind und im wechselseitigen Interesse auch untereinander vernetzt sind. Sie sind eine Zielgruppe für eine derartige Idee. Aber über diese Gruppe hinaus - was ist von der „Mineralienkunde“ gegenüber einem grossen Publikum zu erwarten. Sehr spezielles Bildungswissen zu erwerben? Und genügt die gute Absicht der Wissensvermittlung noch oder sind nicht längst Angebote nötig, die sowohl partizipativ wie reflexiv sein müssen und die über die Vermittlung von museumsspezifischem Sachwissen weit hinausgehen?
Jetzt noch mal zurück zum Pesssimismus: Ich teile den von Pomian nicht, einfach deshalb, weil ich keine sichere Prognose habe. Mich interessiert aber, wie bei Stephen Weils Text zum „Museum at the End of the Time“, die Radikalität der Provokation, die darin steckt das Museum von seinem Ende her zu denken. Man kann derlei Texte gewissermaßen therapeutisch lesen, als Anregungen, sich einer Krise zu stellen und nach neuen Wegen zu suchen.
Pomian übertrifft den Schock, den die politische und praktisch folgenreiche Einschätzung der Museen durch die Politik als zur Unterhaltungsindustrie gehörig ausgelöst hat. Ihnen „Systemrelevanz“ abzusprechen (ich übergehe mal die Frage, „welches System“ eigentlich?) stellt ja auch ihre Existenz in Frage. Pomians Text schneidet indes weitaus tiefer als jede politisch verordnete Maßnahme in das historische Selbstverständnis des Museums als gattungsgeschichtliches Archiv und Gedächtnis (ihn interessiert merkwürdigerweise eher nur das Archiv). Es droht in seiner Perspektive die Möglichkeit als solches endgültig verloren zu gehen, was uns alle, die Gattung als Ganzes einer zukünftigen vollkommen Erinnerungslosigkeit ausliefern würde.
Schon durch den Holocaust wurde, wie Alain Finkielkraut zeigte, etwas Grundlegendes zerstört - das Vertrauen in einen alle Katastrophen, Opfer und Verheerungen aufwiegenden und integrierenden humanen und unabschliessbaren Fortschritt. Jetzt ist aber nicht einfach die Idee des Fortschritts beschädigt, jetzt scheint es ein Datum für dessen unausweichliches Ende zu geben. Nur der Zeitpunkt steht noch nicht fest.
Diese Kränkung ist so ultimativ, daß es schwer fällt, sich auch nur intellektuell, abstrakt, distanziert, probehalber damit zu beschäftigen und schon gar nicht dann, wenn man sich mitten in der Praxis um die Vitalität der Institution inmitten bedrohlicher Krisen sorgen soll.
Stephen Weils Text zum „Museum at the End of the Time“ war ein „sokratischer“ Text, der zur Reflexion anleiten sollte ohne den Hintergrund einer empirisch drohenden Katastrophe. Man konnte spielerisch mit ihm umgehen und verschiedenste Szenarien erproben, die fern jeder Wirklichkeit schienen. Aber schon die Texte waren, sooft ich ihn sie in Diskussionsrunden einbrachte, meist überfordernd. Wie erst der Pomians!
Es geht doch darum, im Bewusstsein aller dieser extremen Herausforderungen, praktisch und theoretisch am Neuentwurf der Institution zu arbeiten. Einen Aufbruch kann es geben, wenn Museen bereit sind, sich offensiv und reflektiert mit dieser „Bedrohung" auseinanderzusetzen (die noch komplexer ist als es Pomian, den es kommen ja noch andere Herausforderungen hinzu, wie etwa die Frage des Umgangs mit dem Kolonialismus) und diese Auseinandersetzung zum Ausgangspunkt ihrer "Erneuerung" machen.
Vom wem wird diese Erneuerung kommen, von den Museen (allein)? Von der Politik? Vom Publikum, von der Zivilgesellschaft? Helmut Bien ist gegenüber neuen Eliten skeptisch, deren rabiate Kritik, etwa an der Kolonial-Frage, letztlich in einen Museoklasmus mündet. Er schreibt: „Wir erleben im Augenblick einen ikonoklastischen Rigorosismus, der vieles Altes aus der Perspektive der aktuellen Moral verantwortlich macht und beseitigen möchte.“
Einspruch. Sehen wir uns die Kolonialismusdebatte an. Ist sie bloß eine Angelegenheit rigoroser elitistischer Moral? Da gab es doch schon zeitgenössisch eine moralische Haltung, die sich mit den Verhältnissen nicht abfand und eine Bürgerbewegung, die etwa den belgischen König dazu zwang, seinen entsetzlichen „Privatkolonialismus“ aufzugeben und dann auch den Belgischen Staat erfolgreich drängte, sich von der Kolonialisierung zu verabschieden. Die europäische Kolonialgeschichte wurde schon zeitgenössich als grauenhaft und unerträglich empfunden, und nicht erst im Licht des heutigen Moralismus von Eliten.
Kolonialismus, als Problem für Museen erst mit der Gründung des Humboldt-Forums aufgebrochen, ist aber nur eine unter mehreren jüngsten Entwicklungen (die Restitutionsdebatte um in der NS-Zeit als zeitlich und territorial ungleich eingegrenzteres Phänomen, geht dem voran). An ihr ist Gewaltförmigkeit und Rechtsbrüchigkeit als strukturelle Grundlage des Museums sichtbar geworden sind. Die gerade anlaufende Debatte über den kolonialen Ursprung des British Museum (wiederum nur eine Facette von mehreren in der Kontaminierung dieses Museums mit Kolonialismus), ist nur eins unter zahllosen Museen, wo man auf ähnliche gewaltförmige Bedingungen ihrer Gründung stossen kann. Da sind so illustre Museen drunter, wie das Metropolitan Museum, der Louvre oder die Tate Gallery.
Keine andere kulturelle Institution oder Praktik hat eine derart verborgene und verborgen gehaltene Tiefenstruktur und zusammen mit der Funktion von Museen als hegemoniale ideologische „Staatsapparate“ bietet allein schon diese beiden Strukturmerkmale erste und dringlich der Bearbeitung harrende Ansatzpunkte und Angriffsflächen für einen „reflexiven Neustart“.
Allerdings frage ich mich, ob alle diese Phantasien vom Neuanfang, vom Museum 2.0, vom demokratischen Museum oder gar radikaldemokratischen Museum, nicht unvermeidlich darauf hinauslaufen, eine vielfach fragwürdige Institution bloss reformerisch am Leben zu erhalten wie einen im Koma liegenden Patienten durch Apparate. Warum nicht loslassen? Warum nicht verabschieden? Nicht um einen revoltierenden Museoklasmus herbeizuführen, sondern um die Ideen zu bewahren, die mit dem Museum einmal verknüpft waren.
Warum nicht alle jene hehren Ziele, die in bester Absicht das Museum neu zu denken formuliert wurden, anders und anderswo zu verwirklichen. Wozu der mühsame Prozess, widerstrebende Praktiken zu verändern (aus Macrons Ankündigung der umfassenden Restitution bleiben zwei Jahre danach eine Handvoll noch nicht mal zur Gänze restituierter Objekte), wozu der lange Marsch durch Institutionen, die es nicht anders haben wollen als es ohnehin ihrem unbeirrbaren Selbstbild nach immer gut ist? Wozu die Hoffnung auf dem (Um)Weg der Instrumentalisierung einer womöglich komplett ungeeigneten Institution, die nötigen Entwicklungs- und Lernprozesse anzustossen?
Der Wechsel von Eliten, geht der ohne jeglichen Wechsel der Perspektiven vor sich oder gar hin zum Schlechteren, oder kann man nicht auch Hoffnung in neue Interessenten setzen, die ihre Verantwortung entdecken?
Ein Beispiel: Es gibt seit Mitte des Vorjahres Kritik an einem der absonderlichsten Museen, die es in Österreich gibt, am Heeresgeschichtlichen in Wien. Die Kritik begann nicht mit einer an den Ausstellungen, sondern an rechtsradikalen Mitarbeitern und einschlägigen Veranstaltung und dem Angebot des Museumsshop mit einschlägigen Tendenzen. Diese Kritik kam von zwei Bloggern, wurde dann von Tageszeitungen aufgenommen und führte zur Einsetzung mehrerer Untersuchungskommissionen. Inzwischen formierte sich eine Gruppe von LiteratInnen und KünstlerInnen, die eine Tagung auf die Beine stellten, die wiederum medial aufmerksam rezipiert, dazu führte, dass das Thema auf der Tagesordnung blieb.
Die Kritik weitete sich nun auf die Ausstellungen aus, auf deren Ideologie und auf die Sinnhaftigkeit eines nostalgisch-retrospektiven Armeemuseums. Die Kommissionen, nicht alle haben ihre Arbeit abgeschlossen, bestätigten im Kern die Kritik und ein Rechnungshofbericht listete Mängel auf, die alles bisher Bekannte bei weitem übertrafen. Eine weitere Tagung ist geplant, von derselben Gruppe, die es geschafft hat, das Thema nun über langen Zeitraum in der öffentlichen Aufmerksamkeit zu halten. Ob das politisch erfolgreich werden wird und in welchem Umfang, das ist völlig offen.
Es ist meiner Beobachtung das erste Mal, daß es so etwas wie eine umfassende Kritik an einem Museum (in Österreich) überhaupt gibt und dass es eine zivilgesellschaftliche Initiative ist, die Museen als wesentliche Akteure der Geschichtspolitik kritisiert. Eine Elite? Prinzipiell ja, aber es ist eine Elite, die gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt und nicht ihre partikularen Interessen. Und das in einer Weise, wie sie dem Museum seit der Aufklärung und bürgerlichen Revolution eingeschrieben ist. Das Museum war ein Ort, in dem Staatsbürger in ihrem und im gesellschaftlichen Interesse handelten und zu Res Publica formierten und das Wohl des gesellschaftlichen Ganzen aushandelten.
Die genannte Initiative ist jedenfalls der seltene Fall, daß sich im Macht- oder Entscheidungsdreieck Politik - Institution - Gesellschaft, die strukturell Ausgeschlossenen, das Publikum, die Bürgerschaft, zu Wort melden. Es ist wie im Gesundheitssystem. PatientInnen haben keine Stimme, keine Handlungsmacht im Verhältnis zu Politik, Industrie und organisierter Ärzteschaft.
Diese Entwicklung beobachte ich mit Interesse und Sympathie. Wer weiss, was da zustandekommt. Ob es bei einem Reförmchen des Heeresgeschichtlichen Museums bleibt, das das Versagen der Politik und das Agieren des Museums kaschiert oder ob es zu einer grundlegenden Erneuerung kommt, nach der vielleicht ein ganz anderes Museum realisiert werden wird, das wird sich zeigen. Es muß am Ende ja nicht ein (neues, weiteres) Museum sein, sondern vielleicht etwas, woran wir jetzt noch gar nicht denken. Etwas, das weitere Museen inspiriert, ganz neue Wege zu gehen.
Vielleicht muß man das Museum verabschieden können, um es völlig neu zu erfinden?
Die erwähnten Texte:
Krzysztof Pomian: Wie schlecht steht es wirklich um die Zukunft der Museen? In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 24.11.2020, S.12
Stephen Weil: The Museum at the End of the Time. In: ders.: Making Museums Matter. Washington. Smithsonian Institution 2002
Gottfried Fliedl: Am Ende. Das Museum. In: Museologien (Blog).
https://museologien.blogspot.com/2020/11/am-ende-das-museum.html
12.12.2020