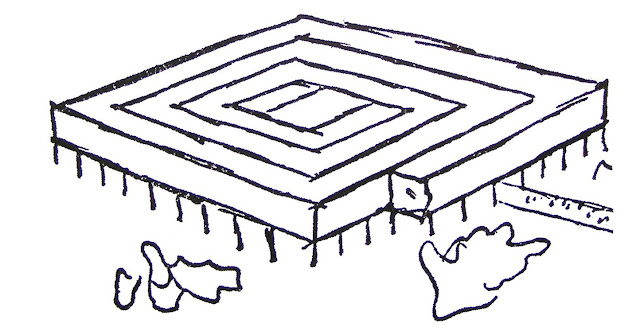Dieser Vortragstext ist 1991 in „Ganz aus dem Häuschen“ erschienen, der Nachlese zu den 12. Museumspädagogischen (Privat-)Gesprächen, die damals in Graz stattgefunden haben. (MuseumspädagogInnen verlassen das Museum. Graz 1991 („...das lebende museum ... STEIERMARK“ im Grazer Stadtmuseum / Kulturvermittlung Steiermark / Kunstpädagogisches Institut Graz). Seite 6-12)
Unsere Vorstellung vom Museum ist wie selbstverständlich die vom festen Haus und Ort. Es geht um Schutz und Sicherheit, um Zusammenfassung, Ordnung, um Vergleichbarkeit und Zugänglichkeit. Erst durch die Fixierung des Ortes, die Dauerhaftigkeit der Sammlung und eine über längere Zeit unveränderte Schaustellung kann der Museumsbesuch zum wiederholbaren Ereignis mit erwartbaren Erfahrungen werden. Doch ist diese Vorstellung vom Museum nicht besonders alt im Verhältnis zur langen Geschichte des Sammelns. Das Museum als Haus - architektonisch und metaphorisch verstanden - ist die Form, die sich erst die bürgerliche Museumsidee gibt.
Zwischen 1815 und 1830 entstand in Berlin ein 'museion' besonderer Art. Ein speziell und nur für den Zweck entworfenes und errichtetes Haus, das bedeutendste Teile des Kunstbesitzes des preußischen Königs aufzunehmen und öffentlich zum Zweck der Bildung zu zeigen hatte. Es ist dieses von Karl Friedrich Schinkel entworfene Neue Museum, meinem Wissen nach der erste selbständige, zu öffentlichen Bildungszwecken errichtete Sammlungsbau, eine Bau zudem, der diesen Zweck mit den Mitteln der Architektur, der Monumentalmalerei und durch die städtebauliche Disposition veranschaulichte.
Mit der offenen, über beide Geschosse reichenden ionischen Loggia, mit der offenen Treppenanlage, die zu einer ebenfalls nach Außen offenen Halle im Obergeschoß führte, bildete der Architekt eine den Binnenraum des Museums mit dem öffentlichen Raum der Stadt verknüpfende Vermittlungssphäre, in der eine Zyklus von Wandgemälden mit der Darstellung der konfliktreichen Gattungsgeschichte auf den eigentlichen Museumsbesuch vorbereiten sollte.
Diesen öffentlich-kommunikativen, bilderreichen und ,bildenden', zwischen institutioneller und städtischer Öffentlichkeit vermittelnden Raum, die obere Halle, hat Schinkel selbst in einer ihren Zweck programmatisch visualisierenden Zeichnung festgehalten.
Doch nicht nur dies und die selbstbewußte Entgegensetzung der bürgerlich-öffentlichen Sphäre zum gegenüberliegenden Schloß sind bemerkenswert, sondern auch die Integration der musealen, über die ausgestellten Sammlungen evozierte Bildungserfahrung in den von den Wandgemälden erzählten gattungsgeschichtlichen Zusammenhang. Dargestellt waren in der Loggia und Treppenhalle u.a. das Götter- und Menschenleben, Kriegs- und Naturgewalt, die Gestirne usw., also nicht mehr und nicht weniger als "die Bildungsgeschichte der Welt", wie es in einer zeitgenössischen Interpretation heißt.
Wilhelm von Humboldt hatte als Leiter der Museumskommission das Konzept eines Museums entworfen, das die Humanisierung der Staatsbürger - also auch die Humanisierung des preußischen Staates - zum Ziel hatte. Im Freskenzyklus wird diese Instrumentalisierung des Museums als Bildungsanstalt des Staates und der Staatsbürger, als zentrale Einrichtung, auf die sich der preußische Staat berufen und fundieren möchte, eingebettet in die Bildungsgeschichte der Gattung überhaupt. Vermittelt und zugleich extrem gespannt scheint hier das Verhältnis von Innen und Außen, von Haus und Welt, von Sammlung und Bildung.
1827 brach ein Streit über die Benennung dieses im Bau befindlichen Hauses aus. Der erste Vorschlag für eine lateinische Inschrift stieß auf Mißfallen: FRIDERICVS GVILELMVS III STVDIO ANTIQVITATIS OMNIGENAE ET ARTIVUM LIBERALIVM MVSEVM CONSTITVIT MDCCCXXVIII, in der deutschen Übersetzung: Friedrich Wilhelm III. hat dem Studium jeder Art Alterthümer und der freien Künste diesen Ruheort gestiftet 1828.
Das Wort Museum, das in der deutschen Übersetzung merkwürdiger- und bezeichnenderweise nicht übersetzt und durch das eigentümliche Wort ,Ruheort' ersetzt wurde, war der Stein des Anstoßes. Die Einwände richteten sich gegen den Begriff Museum. Mit dem Wort Museum würden, so der erste Gutachter, "im ganzen Alterthume" nur Orte der Wissenschaft bezeichnet, aber niemals solche zur" Aufbewahrung von archäologischen oder Kunstgegenständen". Zwar sei der Sprachgebrauch Museum der populäre, niemals aber der klassische und daher für eine Inschrift ungeeignet. Ludwig Tieck, Alexander von Humboldt und die um ein Gutachten gebetene historisch-philologische Klasse der Preußisch-Königlichen Akademie der Wissenschaften kamen sinngemäß zu demselben ablehnenden Ergebnis.
Zum Zeitpunkt der Errichtung des Berliner Sammlungsinstituts ist der Begriff Museum noch keineswegs für Sammlungen und Sammlungsarchitekturen ausschließlich reserviert. So wie er für Vereine, Gesellschaften, Publikationen, literarische Sammlungen usw. auch gebräuchlich ist, können umgekehrt museale Sammlungen noch als Kabinette, Glyptotheken, Pinakotheken, Galerien usw. benannt werden.
Doch der kurze, scheinbar nebensächliche Streit um die Benennung des durchaus als neuartig empfundenen Baus ist mit der terminologischen Offenheit nicht ganz zu erklären.
Interessant an dem Streit ist, daß zwei Traditionen des Begriffs Museum aufeinandertreffen. Die eine Tradition, die die Gutachter und Experten gegen die Verwendung des Wortes Museum für einen Ort der Sammlung ins Treffen führen, leitet sich vom klassisch-antiken Wortgebrauch ab. Das heißt, von der Bezeichnung Museum für eine Pflegestätte der Wissenschaft an der aber nicht gesammelt, vor allem aber nichts Vergangenes, Historisches aufbewahrt wurde.
Die andere Tradition, von der es in den Gutachten heißt sie sei die populäre, ist offensichtlich die ältere. In dieser Tradition lebt etwas von der Bedeutung des ursprünglicheren museion, des Musenortes fort. Also von der antiken Tradition, die im16. Jahrhundert wiederentdeckt und wiederaufgenommen wurde- und zwar damals in der doppelten Bedeutung von Hain, Garten jedenfalls den Musen gewidmeten Naturraum und Ort der wissenschaftlichen Betätigung und des Sammelns. Indem man gegen die eigene philologisch untermauerte, rationale Kritik, die die Begriffsübertragung von Museum als Bezeichnung eines Ortes der Wissenschaft auf ein Sammlungshaus - historisch übrigens korrekt - als unantik ablehnt, am Begriff Museum dann aber doch festhält, entschied man sich für die ungleich ältere Bedeutung, also unbewußt, nämlich ohne sich Rechenschaft über den Sinn dieser älteren Tradition zu geben.
In der Erinnerung an diese sogenannte populäre und älteste Bedeutungsschicht des Wortes Museum blitzt die Erinnerung sowohl an das museion als Ort des kollektiven Gedächtnisses auf, als auch die an einen lang zurückliegenden, längst verschütteten, konfliktreichen Enteignungsprozeß.
In diesem Enteignungsprozeß wurde die schrift- und bildlose, affektive und ausschließlich von weiblichen Musen beschützte, kollektive und gattungsgeschichtliche Erinnerungsfähigkeit durch die rationale, textgebundene von den ausschließlich männlichen Priestern wissenschaftlicher Institutionen betriebene Gedächtnisarbeit allmählich abgelöst und verdrängt.
Der griechisch antike Begriff museion meinte ursprünglich den Ort der Musen, Töchter der Mnemosyne, der Göttin des Gedächtnisses und des Zeus. Zuerst ist es eine einzelne Muse - das Wort Muse bedeutet die Sinnende oder die Erinnernde - später sind es drei oder neun, ihre Zahl schwankt. Sie sind Naturgeister, Nymphen und leben anQuellen und Flüssen, wo sie im ekstatischen, göttlich inspirierten Gesang und Tanz die Vergangenheit und Zukunft in die Gegenwart beschwören, weissagen, deuten.
Das museion wurde dann die den Musen geweihte Stätte der Pflege der Erinnerung und des Eingedenkens an die konfliktreiche Geschichte der Zivilisation. Kunst, Geschichte und Wissenschaft hatten spezielle Schutzmusen, die für das Festhalten der Erinnerung einstanden und die vor allem die Rhapsoden beschirmten, die zu Beginn ihres Gesanges die Musen anriefen, als Garanten für die Wahrheit des von ihnen vorgetragenen Stücks Gattungsgeschichte.
.
Es wurden den Musen Altäre errichtet, Bilder der Musen aufgestellt und der Hain, das museion, wurde zum Versammlungs- und Festplatz vornehmlich von Künstlern, dann auch zur Sammelstelle für Weihegaben und Opfer. .
Als Beschützerinnen der Künste und des Geistigen wurden die Musen später zu Schutzpatroninnen von Schulen, Gymnasien, philosophischen Akademien, wie z. B. der platonischen Akademie und liehen ihren Namen dem alexandrinischen Museion, einer Stätte der Gelehrsamkeit, das seither oft fälschlicherweise als ,erstes Museum der Geschichte' bezeichnet wird. Aus dem museion als mythischem, vage lokalisierbaren Naturraum wird allmählich eine Topografie der institutionellen Wissenschaft.
"Keine bessere Gelegenheit findet man nun zu dieser fast mit himmlischer Lust verknüpften Betrachtung der Natur, als in Museis oder solchen Orten, welche ausdrücklich dazu an einer bequemen und einsamen Stelle angeordnet sind, wo selbst man gleichsam alle unnütze Geschäfte und weltlichen Rumor verläst, dagegen aber seine Sinnen und Gedanken zusammen ruft, und einzig und allein zur Ehre Gottes in der Betrachtung aller seiner Wunder anwendet. Hier sitzt er [der Forscher; G. F.] also ausgeschlossen und umgeben mit herrlichen, raren, wunderbaren und fremden Sachen, über deren Anschauung seine leiblichen Augen in angenehme Ergätzung und Fröhlichkeit gerathen."
So beschreibt Neickelius Anfang des 16. Jahrhunderts die Freuden des solipsistischen Gelehrten in seinem privaten Refugium. Es ist das 16. Jahrhundert, das, zu erst in Italien, das museion wiederentdeckte, und zwar als privaten, in das Haus, das Schloß, den Palast integrierten Ort des Studiums und des Sammelns.
Das musaeum des 16. Jahrhunderts rekonstruiert ,klassisches' Wissen, den ,antiken Text' und sammelt dafür Material, nun aber nicht nur schriftliche Überlieferungen, also Manuskripte oder Inschriften, sondern Gegenstände, wie Kleinplastiken, Münzen, Naturobjekte, Mineralien, Pflanzen und Tiere - das Präparieren und Konservieren wird im 16. Jahrhundert zu einer Basistechnik von Musealisierung. Das Museum ist ein gleichsam archäologisches Unternehmen, in dem durch Sammeln, Vergleichen und Ordnen von Material ein ,Text' gebildet werden kann.
Der Begriff Museum strukturiert Praktiken des zwischen Privatheit und Öffentlichkeit changierenden Umgangs mit Wissen im Kontext sozialer Bestimmungen wie ,Prestige', ,Wissen', ,Wahrnehmung', ,Klassifikation' und ist zugleich humanistisch und enzyklopädisch. Die Welt ist im Museumsraum exemplarisch und geordnet präsent. Das musaeum wird vor allem ein Lokalisationsprinzip, eine Definition von Orten, an denen Lernen stattfinden kann.
Einerseits ist das Museum, wie das Zitat von Neickelius zeigt, ein kontemplativer Ort, an dem - vom lärmenden Treiben des Alltags fern -, gleichsam mönchische Arkanpraktiken des Wissenserwerbes und der Wissenspflege ihren Platz haben. Andrerseits sprengt das Enzyklopädische des Museums den Raum der Gelehrtenstube. ln der Reformation und Gegenreformation, auch durch die dadurch ausgelösten politischen Katastrophen und durch die das Weltbild sprengenden Expeditionen und Entdeckungen gerät das arkanhafte, private Sammeln in eine Krise. Die Integration exotischer Fundstücke in das Sammeln sprengt die herkömmlichen Museumsordnungen. Das Sammeln spiegelt nun, ab dem 17. Jahrhundert, eine alogischere, pluralistischere Weit wieder. Die instrumentelle und pädagogische Bedeutung von Sammlungen zieht Publikum auf sich und es entwickelt sich das Museum über das Private hinaus zum sozial und kulturell zweckgerichteten Ort.
Zum qualitativ Neuen der zu Ende des 18. Jahrhunderts etablierten Museumsidee gehört erstens die Ausdehnung der Publizität des Museums zum radikaldemokratischen Anspruch, uneingeschränkt jedermann das Museum als Ort der Erfahrung von Geschichte zugänglich zu halten. Und zweitens: die Historisierung der Sammlung und ihrer Wahrnehmung.
Das Museum wird zum Gang durch die Zeit, durch die Geschichte. So wurde bei dem erwähnten Berliner Museum erstmals eine historisch-chronologische und nach Schulen gegliederte Disposition der Sammlung vorgenommen. Die sorgfältig überlegte Hängung sollte das Vergleichen möglich und die historische Anordnung - auch unerstützt mit didaktischen Hilfsmitteln -, erfahrbar machen.
Die Abtrennung des Museumsortes von der ,übrigen Welt', als einem Ort, an dem die Dinge gleichzeitig sind, konstituiert Geschichte. Das Museum wird im 19. Jahrhundert in diesem Sinn ein Ort der unendlichen Akkumulation, in der "die Zeit nicht aufhört, sich auf den Gipfel ihrer selbst zu stapeln und zu drängen, während im 17. Jahrhundert und noch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts die Museen (...) Ausdruck einer individuellen Wahl waren.“
Die Idee, im Prinzip unvereinbare Zeiten und Räume, unvereinbare Stile und Epochen, unvereinbare Objekte an einem Ort zusammenzubringen, ist von der Idee beherrscht, die Zeit selbst aufzuheben, die Dinge, die Massen des Ererbten vor der Zeit selbst in Sicherheit zu bringen.
In diesen Dienst stellt sich eine museale Archäologie, die das mit den Toten bestattete Erbe, die selbst unsere Vorfahren aus den Gräbern holen wird, in diesen Dienst stellen sich die Raub- und Beutezüge der Moderne, die die Akkumulation musealer Sammlungen erst ermöglichen.
Das Selbstbild, das Museen von ihrer Entstehung und Entwicklung als Sammlung haben, ist das eines friedlichen und stetigen, gleichsam natürlichen Wachstums. Eine lange Geschichte glücklicher Funde, der Sammlerleidenschaft, von Geschick urid List begnadeter Persönlichkeiten, die mit Instinkt und Reaktionsvermögen, das Erbe mehrten.
Bei näherem Hinsehen erweist sich dieses Wachstum als Geschichte gewaltförmiger und widerrechtlicher An- und Enteignungen: vom Bildersturm und Bilderraub der französischen Revolution bis zur Arisierung der NS-Zeit, von der Säkularisation, aus deren profaniertem Strandgut bedeutende europäische Museumsgründungen hervorgegangen sind bis zu den jüngsten Plünderungen des Irak in Kuweit, von den Expeditionen und Jagdkampagnen der Naturhistorischen Museen bis zur mit Zwang durchgesetzten und als freiwillige Schenkungen verbrämten Ablieferung von Kunstwerken und Kulturgütern der kolonisierten Länder an die Staaten Europas und Nordamerikas reicht die lange Kette widerrechtlicher und gewalttätiger Enteignung.
Auch die friedlicheren Prozesse der Vermehrung des Museumsgutes erweisen sich bei näherem Hinsehen mit Gewalt verbunden. Die bürgerliche Museumsidee ist eng mit einer reaktiven und kompensativen Bewegung verknüpft.
Ein sich beschleunigender zivilisatorischer Wandel läßt immer mehr Gegenstände immer rascher veralten. Diese Gegenstandsmassen werden nun weder auf Müllhalden geworfen, noch dem natürlichen Verfall noch der Zerstörung überlassen, sondern ziehen - als geschichtliches Gut oder als ästhetisch faszinierende Überreste - in immer neue Museen ein. ·
In der Schweiz etwa, einem Land mit der relativ größten Museumsdichte Europas
(nach Liechtenstein) wird derzeit durchschnittlich in jedem Monat ein neues Museum gegründet.
Die Masse der toten Arbeit vermehrt sich also mit unglaublicher Rasanz und der Widerspruch zwischen dieser Masse an toter Arbeit und der lebendigen Arbeit wird im mer schärfer.
Mit anderen Worten: die Möglichkeit, diese in Schausammlungen, Depots, Lagern
und Kellern, Tiefspeichern und Studiensammlungen aufgehäuften Mengen an Dingen durch wissenschaftliche oder pädagogische Arbeit wieder zum Leben zu erwecken, wird immer unwahrscheinlicher und immer vergeblicher.
Für die wohl meisten Museen gilt ja, daß vor allem die wissenschaftliche Arbeit in quantitativer Hinsicht immer weiter hinter dem Sammeln, dem schieren Anhäufen, dem Horten hinterherhinkt. ln einem Prüfbericht des Rechnungshofes zu den Wiener
Bundesmuseen z. B. finden sich eindrucksvolle Zahlen dazu. So ist am Naturhistorischen Museum in Wien nicht einmal mehr die wissenschaftliche lnventarisierung möglich, wenn allein in der anthropologischen Sammlung jährlich 4000 Skelettreste anfallen.
Wenn aus lebendiger menschlicher Arbeit tote, verdinglichte Arbeit wird, so ist das ein Enteignungsprozeß. Die, die einen Gegenstand hergestellt, bearbeitet, benutzt und genossen haben werden vom Produkt ihrer Arbeit getrennt.
Musealisierung ist ein solcher Enteignungsprozeß. Und er findet längst nicht mehr nur im und durch das Museum statt. Die Metapher von der Weit als Museum, die in den letzten Jahren in Umlauf gebracht wurde, beschreibt das Platzen des Museums. Die Obsession, immer größere Lebensbereiche, ganze Naturbezirke und Stadtgelände, Ensembles von Monumenten oder sogar vom Verschwinden bedrohte Arbeits und Lebensweisen bewahren zu wollen, ist die scheinbar grenzen- und widerstandslose Ausdehnung der Idee des Museums als Ort des Zeitstillstandes auf die ganze Welt.
Noch einmal: die Masse der toten Arbeit wächst beständig. Die Chancen, sie wieder in lebendige zurückzuverwandeln, schwindet aber nicht nur mit ihrer Massenhaftigkeit. Tote Arbeit übt Macht aus. Gegen die immens langfristigen Bewegungen ihrer Anhäufung scheinen die kurzen Zeit- und Lebensspannen, derer, die ihr gegenüberstehen ohnmächtig.
Zudem: Die Spezialisten im Umgang mit toter Arbeit wurden und werden enteignet. Und gerade die, die Herrschaft über tote Arbeit ausüben - die Kustoden, die Museumspolitiker und -verwalter -, verstehen nicht, oder nicht immer, mit ihr umzugehen. Ein Beispiel sind etwa industriehistorische Museen, die Arbeiter einstellen, um Maschinen zu warten, in Gang zu setzen und sie Besuchern zu erläutern.
Museen, die in der Verfügung derer stehen, deren Erinnerung sie enthalten, sind die seltenste Ausnahme. Bei der Mehrzahl der Museen werden die Produzenten von ihren Produkten und Produktionsmitteln durch Musealisierung getrennt und sie werden selbst zu Museumspublikum. Zu Konsumenten ihrer eigenen Vergangenheit, die ihnen als verwissenschaftlichte, erzählte und strukturierte Vergangenheit noch einmal enteignet wird - unter einem fremdbestimmten Zugriff auf den sie keinen Einfluß haben. Tote Arbeit kann für ihre Produzenten selbst zum Mittel der Unterdrückung werden.
Wo aber jeder lebendige Umgang mit der Hinterlassenschaft fehlt oder versagt, bildet sich eine unheimliche Gegenständlichkeit aus der noch der letzte Rest an Erinnerung an vergangene Arbeit und Geschichte gewichen ist.
Es entsteht massenhaft "Verdinglichung" und das "bedeutet, menschliche Phänomene aufzufassen, als ob sie Dinge wären", was bedeutet, "daß der Mensch fähig ist, seine eigene Urheberschaft der humanen Weit zu vergessen, und [...] daß die Dialektik zwischen dem menschlichen Produzenten und seinen Produkten für das Bewußtsein verloren ist." Wo solche unheimliche Gegenständlichkeit in die öffentlich zugänglichen Schausäle einwandert, bildet sich immerhin noch die Erfahrung von Fremdheit, Andersartigkeit, von Alterität, das Museum kann zu einer Schule des Befremdens werden, in der inoffizielle Hinsichten, Blickweisen eingeübt werden könnten. Doch diese neue Diskussion über das Museum als Schule des Befremdens (Sloterdijk) und Ort der Alteritätserfahrung (Waldenfels) sieht im Museum nur noch den Ort der spielerischen Einübung in das Befremden und benützt die durch Musealisierung erzwungen Distanz nicht mehr zur Kritik von Musealität und ihrem Zustandekommen.
Aber das Fehlen von eigensinniger, kritischer und lebendiger Arbeit oder ihre Ohnmacht angesichts der Menge und Last der Überlieferung erzeugen Realitätsverlust. Denn nur dann ist tote Arbeit tot, wenn sie nicht mehr in Beziehung zu setzen ist zu lebendiger Arbeit, denn nur diese Beziehung konstituiert Realität. Das Glück, die Erfahrung, der Genuß liegen nicht in den Dingen, sondern in den Beziehungen zu ihnen und an die Beziehungen, an die uns die Dinge erinnern.
Vermittlungsarbeit, die sich etwa unter der Prämisse der Objektvermittlung glaubt in den Dienst ,der Sache', d. h. auch: des Museums als Agentur des Erbes als stellen zu müssen, begnügt sich damit, mit den Resultaten von Musealisierung und mit institutionellen Sachzwängen unter Würdigungs- und Anerkennungspflicht zu operieren. Vermittler sind dann bloß Erbstauhelfer und Besichtigungsministranten.
Daher: Raus aus dem Museum!